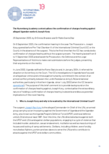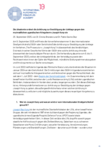25. September 2025, von Dr. Emma Brandon und Dr. Pablo Gavira Díaz
Am 9. September 2025 eröffnete die Vorverfahrenskammer III des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH oder Gerichtshof) die Anhörung zur Bestätigung der Anklage im Verfahren „The Prosecutor v. Joseph Kony“ in Abwesenheit des Verdächtigen. Erstmals in seiner Geschichte führte der IStGH eine solche Anhörung ohne die Anwesenheit der beschuldigten Person durch. Die Verhandlung dauerte vom 9. bis 11. September 2025 und bot der Anklagebehörde, der Verteidigung sowie den Rechtsvertreter:innen der Opfer die Möglichkeit, mündliche Stellungnahmen abzugeben und ihre Argumente zur Sache vorzutragen.
Im Juni 2002 ratifizierte Uganda das Römische Statut und unterbreitete die Situation im Januar 2004 an den Gerichtshof. Die Ermittlungen des IStGH in Uganda konzentrierten sich auf mutmaßliche Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die seit dem 1. Juli 2002 – dem Beginn der Gerichtstätigkeit – im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt zwischen der Lord‘s Resistance Army (LRA) und den ugandischen Behörden, insbesondere im Norden des Landes, begangen wurden. Ziel dieses Beitrags ist es, Hintergrundinformationen zur Anhörung zur Bestätigung der Anklage gegen Joseph Kony zu geben, die außergewöhnliche Natur einer solchen Anhörung in Abwesenheit zu erläutern und mögliche Auswirkungen dieses neuartigen Vorgehens zu diskutieren.
1. Wer ist Joseph Kony und warum wird er vom Internationalen Strafgerichtshof gesucht?
Joseph Rao Kony ist der mutmaßliche Oberbefehlshaber der LRA, einer bewaffneten Gruppe, die seit mindestens 1987 einen Aufstand gegen die Regierung Ugandas, die ugandische Armee (Uganda People’s Defence Force, UPDF) sowie lokale Verteidigungseinheiten führt. In dieser Zeit verübte die LRA Angriffe sowohl gegen staatliche Kräfte als auch gegen die Zivilbevölkerung. Dabei kam es zu schweren Gewalttaten wie Mord, Entführungen, sexueller Versklavung, Verstümmelungen, Plünderungen und Brandstiftungen. Zivilisten – darunter auch Kinder – wurden unter Zwang als Kämpfer, Träger und Sexsklavinnen rekrutiert, um der LRA zu dienen und an Angriffen mitzuwirken.
Vor diesem Hintergrund leitete der IStGH im Juli 2004 offiziell Ermittlungen ein. Dabei ging es um mutmaßliche Kriegsverbrechen wie Mord, grausame Behandlung von Zivilpersonen, vorsätzliche Angriffe auf Zivilisten, Plünderungen, Vergewaltigungen und die Zwangsrekrutierung von Kindern. Außerdem wurden Verbrechen gegen die Menschlichkeit untersucht, darunter Mord, Versklavung, sexuelle Versklavung, Vergewaltigung und andere unmenschliche Handlungen, die schweres Leid verursachten.
Auf dieser Grundlage erließ die Vorverfahrenskammer II im Jahr 2005 die ersten Haftbefehle des IStGH gegen fünf führende Mitglieder der LRA: Joseph Kony, Vincent Otti, Raska Lukwiya, Okot Odhiambo und Dominic Ongwen.
Zunächst blieben alle Beschuldigten auf freiem Fuß. Dominic Ongwen stellte sich im Januar 2015 dem Gericht. Im Mai 2021 verurteilte ihn die Strafkammer IX wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen in Norduganda zu 25 Jahren Haft. Die Verfahren gegen Otti, Lukwiya und Odhiambo wurden nach ihrem Tod eingestellt. Joseph Kony ist weiterhin flüchtig.
2. Welche Verfahrensschritte hat der Internationale Strafgerichtshof in Bezug auf Joseph Kony unternommen?
Der Haftbefehl gegen Kony wurde am 8. Juli 2005 zunächst unter Verschluss gestellt, am 27. September 2005 geändert und am 13. Oktober 2005 veröffentlicht. Ihm werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit (darunter Mord, versuchter Mord, Versklavung, Zwangsheirat, Vergewaltigung, Folter, schwere Misshandlung, Zwangsschwangerschaft und Verfolgung) sowie Kriegsverbrechen (darunter Mord, versuchter Mord, Folter, grausame Behandlung von Zivilisten, vorsätzliche Angriffe auf die Zivilbevölkerung, Plünderungen, Zerstörung feindlichen Eigentums, Vergewaltigung, sexuelle Sklaverei, erzwungene Schwangerschaft, Rekrutierung und Einsatz von Kindern) zur Last gelegt, die er 2003 und 2004 in Norduganda begangen haben soll.
Zwischen November 2023 und Oktober 2024 erließen die Vorverfahrenskammern II und III mehrere Beschlüsse zur Anhörung gegen Kony, darunter die Genehmigung eines Verfahrens in Abwesenheit sowie Verlegung der Verhandlungen und setzte den entgültigen Beginn der Anhörung auf den 9. September 2025. Im April 2025 legte die Anklagebehörde ein geändertes „Document Containing the Charges“ (ähnlich einer Anklageschrift) vor, in dem Kony 39 Anklagepunkte wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Last gelegt werden, die er zwischen dem 1. Juli 2002 und dem 31. Dezember 2005 in Norduganda begangen haben soll.
3. Was ist eine Anhörung zur Bestätigung der Anklage und warum fand sie in Abwesenheit des Verdächtigen statt?
Eine Anhörung zur Bestätigung der Anklage ist kein Gerichtsverfahren, sondern eine Vorprüfung. Die Vorverfahrenskammer prüft, ob „substantial grounds to believe“ (englisch für „erhebliche Gründe zu glauben“) bestehen, dass die beschuldigte Person die vorgeworfenen Taten begangen hat und ein Hauptverfahren stattfinden soll. Dieser Beweisstandart liegt deutlich unter dem Beweismaß „beyond reasonable doubt“ (englisch für „ohne jeglichen vernünftigen Zweifel”) das für eine Verurteilung erforderlich ist.
Die Richter:innen können dabei alle, einige oder keine Anklagepunkte bestätigen und damit bestimmen, welche Anklagen im Hauptverfahren verhandelt werden. Sie können ihre Entscheidung auch vertagen, um der Anklagebehörde Zeit für weitere Ermittlungen oder Anpassungen zu geben um die vorleigenden Beweise besser geltend zu machen.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen einer Anhörung zur Bestätigung der Anklage und einem Gerichtsverfahren ist, dass eine Bestätigungsanhörung grundsätzlich auch ohne den Verdächtigen stattfinden kann, während ein Prozess zwingend die Anwesenheit des Angeklagten erfordert.
Dass die Anhörung im Fall Kony erstmals in der Geschichte des Gerichtshofs in Abwesenheit stattfand, erklärt sich durch die zwei jahrzehntelangen, erfolglosen Bemühungen, ihn zu Verantwortung zu ziehen. Trotz intensiver und beispielloser internationaler Zusammenarbeit seit der Ausstellung des Haftbefehls, insbesondere durch die umfangreichen Bemühungen der USA – ein Nichtvertragsstaat des IStGH mit einer zeitweise kontroversen Beziehung zum Gerichtshof –, konnte Kony nicht aufgespürt und festgenommen werden.
Ein zusätzlicher Beweggrund war die Verurteilung von Dominic Ongwen, dem mutmaßlichen Komplizen von Kony, im Jahr 2021. Sie zeigte, dass es für viele der Kony zur Last gelegten Taten ausreichende Beweise gibt, und gab einigen Opfern der LRA Verbrechen die Möglichkeit, gehört zu werden und Entschädigung zu erhalten. Da im Ongwen-Verfahren jedoch nur Opfer berücksichtigt wurden, die entführt und in seine Brigade zwangsrekrutiert wurden, blieben Tausende Opfer anderer LRA Verbrechen ausgeschlossen und warteten nach wie vor auf Gerechtigkeit. Die Rechtsvertretung der Opfer betonte dies während der mündlichen Anhörung besonders.
4. Welche Bedeutung hat die Anhörung zur Bestätigung der Anklage für den IStGH?
Trotz jahrzehntelanger Bemühungen bleibt Joseph Kony auf freiem Fuß, und die Opfer seiner mutmaßlichen Verbrechen hatten bislang keine Möglichkeit, ihn vor Gericht zu sehen. Vor diesem Hintergrund beantragte die Anklagebehörde die Anhörung in Abwesenheit, um den Opfern eine Stimme auf internationaler Bühne zu geben und die Weltgemeinschaft erneut an die Dringlichkeit seiner Festnahme zu erinnern.
Darüber hinaus könnte dieses Verfahren als Präzedenzfall für künftige Anhörungen in Abwesenheit dienen – insbesondere bei langjährig flüchtigen Beschuldigten. Beobachter:innen weisen darauf hin, dass das größte Hindernis für den IStGH die mangelnde Unterstützung der Vertragsstaaten sei, vor allem bei der Festnahme von Angeklagten. Derzeit sind auf der Website des Gerichtshofs 29 Personen aufgeführt, die sich weiterhin auf freiem Fuß befinden und deren Festnahme Unterstützung erfordert.
Zur Rolle solcher Verfahren erklärte Akademiedirektor Professor Dr. Christoph Safferling: „die Anhörung zur Bestätigung der Anklage gegen Joseph Kony in Abwesenheit wird zeigen, ob eine solche Anhörung den Opfern ein Mindestmaß an Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht bieten kann.“ Er ergänzte, dass Verfahren in Abwesenheit „im Völkerstrafrecht nichts Ungewöhnliches sind“ und verwies auf die Fälle Martin Bormann vor dem Internationalen Militärgerichtshof sowie Ayyash et al. vor dem Sondertribunal für den Libanon. Zugleich betonte er, dass das Verfahren gegen Kony noch nicht die Phase einer Hauptverhandlung erreicht habe: „und selbst wenn die Anklage gegen ihn bestätigt wird, schließt Artikel 63 Absatz 1 des Römischen Statuts die Möglichkeit von Verfahren in Abwesenheit aus – und das zu Recht“.
Weiter führte er aus, die Nürnberger Prozesse seien „in vielerlei Hinsicht ein außergewöhnliches Experiment gewesen, doch ihre bleibende Lehre ist, dass es für die Glaubwürdigkeit und Wirksamkeit eines Gerichts – und vor allem für die Erfüllung der Erwartungen der Opfer – entscheidend ist, die Verantwortlichen tatsächlich vor Gericht zu stellen.“ Er schloss mit dem Hinweis, dass die Verfolgung von Gerechtigkeit im Fall Kony den Opfern Hoffnung geben könne, warnte jedoch zugleich: „die derzeitigen Bemühungen des IStGH könnten sich letztlich als vergeblich erweisen“, sollte der Angeklagte nicht erscheinen. (pg)