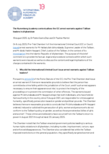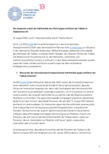19. August 2025, von Dr. Pablo Gavira Díaz und Dr. Pauline Martini
Am 8. Juli 2025 erließ die Vorverfahrenskammer II des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH oder Gerichtshof) im Rahmen ihrer Ermittlungen zur Situation in der Islamischen Republik Afghanistan Haftbefehle gegen Haibatullah Akhundzada, das Oberhaupt der Taliban, und Abdul Hakim Haqqani, den Oberster Richter der Taliban. Ziel dieses kurzen Kommentars ist es, den faktischen, rechtlichen und verfahrensrechtlichen Kontext zu erläutern, in dem diese Haftbefehle erlassen wurden, sowie den Inhalt und die rechtlichen Auswirkungen der darin enthaltenen Anklagepunkte zu analysieren.
1. Warum hat der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle gegen Anführer der Taliban erlassen?
Gemäß Artikel 58 des Römischen Statuts des IStGH erlässt die Vorverfahrenskammer einen Haftbefehl, wenn hinreichende Gründe für die Annahme bestehen, dass die Person ein Verbrechen begangen hat, das in die Zuständigkeit des Gerichtshofs fällt. Die Festnahme muss außerdem notwendig erscheinen, um ihr Erscheinen vor Gericht sicherzustellen, die Integrität des Verfahrens zu wahren oder die Begehung weiterer Straftaten zu verhindern. Die gegen Akhundzada und Haqqani erlassenen Haftbefehle basieren auf dem Vorwurf, dass beide Personen, die seit dem 15. August 2021 faktisch die Macht im Land innehaben, für Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich sind, insbesondere für Verfolgung aus geschlechtsspezifischen und politischen Gründen. Die Kammer ist der Ansicht, dass hinreichende Gründe für die Annahme vorliegen, dass Akhundzada und Haqqani die Verfolgung von Mädchen, Frauen und Personen, die sich nicht an die Geschlechterpolitik der Taliban halten, sowie von Personen, die als „Verbündete von Mädchen und Frauen“ gelten, angeordnet, unterstützt oder ermuntert haben.
Es wird angenommen, dass diese Verbrechen seit der Rückkehr der Taliban an die Macht im August 2021 bis mindestens zum 20. Januar 2025 andauern. Die Kammer stellte fest, dass die Taliban eine Politik betrieben haben, die zu schweren Menschenrechtsverletzungen in Afghanistan führte, zu der unter anderem Mord, Inhaftierung, Folter, Vergewaltigung und Verschleppung gehören. Die Kammer war zudem der Ansicht, dass die Taliban zwar der gesamten Bevölkerung Beschränkungen auferlegten, jedoch insbesondere Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts ins Visier nahmen und ihnen Grundrechte wie Bildung, Privatsphäre, Familienleben und Bewegungs-, Meinungs-, Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit vorenthielten. Nach Ansicht derselben Kammer ging die Verfolgung über direkte Gewalt hinaus und umfasste auch institutionalisierte Diskriminierung durch Gesetze und gesellschaftliche Normen. Darüber hinaus wurden auch Personen ins Visier genommen, die als politische Gegner dieser Politik galten – insbesondere jene, die sich für Frauenrechte einsetzten, sowie Personen, die bestimmte sexuelle Orientierungen und/oder Geschlechtsidentitäten offen zum Ausdruck brachten.
Obwohl die Haftbefehle zum Schutz der Opfer und zur Wahrung der Verfahrensintegrität unter Verschluss bleiben, hat die Kammer beschlossen, deren Existenz im Interesse der Gerechtigkeit öffentlich bekannt zu geben, um weitere Verstöße zu verhindern. Die folgenden Ausführungen beruhen daher auf der Pressemitteilung des IStGH zu den Haftbefehlen – nicht jedoch auf den Haftbefehlen selbst.
2. Was ist geschehen, bevor die Haftbefehle erlassen wurden?
Afghanistan trat dem Gerichtshof bei, indem es am 10. Februar 2003 seine Beitrittsurkunde zum Römischen Statut hinterlegte. Gemäß Artikel 126 Absatz 2 des Statuts wurde das Land am 1. Mai 2003 offiziell Vertragsstaat, wodurch der Gerichtshof die Zuständigkeit für Straftaten erhielt, die ab diesem Zeitpunkt auf afghanischem Hoheitsgebiet oder von afghanischen Staatsangehörigen begangen wurden. Im Jahr 2007 gab die Anklagebehörde des IStGH öffentlich die Einleitung einer Voruntersuchung zur Lage in Afghanistan bekannt, die sich auf mutmaßliche Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen regierungsfreundlichen und regierungsfeindlichen Kräften konzentrierte. Nach Artikel 15 des Römischen Statuts ist eine solche Voruntersuchung ein notwendiger erster Schritt vor der Einleitung einer formellen Untersuchung. Ziel ist es festzustellen, ob genügend Informationen vorliegen, um eine offizielle Untersuchung zu rechtfertigen. Die Voruntersuchung wurde im Oktober 2017 abgeschlossen, als die Chefanklägerin dem Präsidenten des Gerichtshofs ihre Absicht mitteilte, gemäß Artikel 15 Absatz 3 des Römischen Statuts eine formelle Untersuchung einzuleiten.
Im April 2019 lehnte die Vorverfahrenskammer II den Antrag der Chefanklägerin auf Einleitung einer Untersuchung mit der Begründung ab, dass die Einleitung einer Untersuchung nicht im Interesse der Gerechtigkeit liege. Diese Entscheidung wurde im März 2020 aufgehoben, als die Berufungskammer des IStGH der Chefanklägerin die Genehmigung erteilte, eine Untersuchung zu mutmaßlichen Verbrechen im Zusammenhang mit der Lage in Afghanistan einzuleiten, sofern diese in die Zuständigkeit des Gerichtshofs fallen. Die Kammer entschied zudem, dass die Chefanklägerin auch Verbrechen untersuchen könne, die seit dem 1. Mai 2003 auf afghanischem Staatsgebiet sowie seit dem 1. Juli 2002 in anderen Vertragsstaaten begangen wurden, sofern sie in engem Zusammenhang stehen. Trotz eines Aufschubantrags der afghanischen Regierung im März 2020 genehmigte der IStGH schließlich die Wiederaufnahme der Ermittlungen im Oktober 2022 unter Berufung auf das Fehlen glaubwürdiger nationaler Verfahren. Im April 2023 passte die Berufungskammer den Umfang der Ermittlungen weiter an das ursprüngliche Mandat der Chefanklägerin an.
Die Ermittlungen wurden seitdem ausgeweitet, unter anderem durch eine Überweisung der Situation an den IStGH im November 2024 durch sechs Länder, nämlich Chile, Costa Rica, Spanien, Frankreich, Luxemburg und Mexiko. Diese Länder unterstützten die Untersuchung ausdrücklich und hoben die Notwendigkeit hervor, insbesondere die sich verschlechternde Lage von Frauen und Mädchen in Afghanistan zu beobachten. Im Januar 2025 gab der Chefankläger des IStGH bekannt, dass seine Behörde Haftbefehle gegen Akhundzada und Haqqani wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, insbesondere wegen Verfolgung aus geschlechtsspezifischen Gründen gemäß dem Römischen Statut, beantragt habe. Die Haftbefehle wurden, wie oben erwähnt, am 8. Juli 2025 bestätigt.
3. Was bedeutet geschlechtsspezifische Verfolgung, und wird sie im Römischen Statut als Straftat anerkannt?
Verfolgung aufgrund des Geschlechts ist im Römischen Statut kein eigenständiger Straftatbestand. Sie wird jedoch gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe h und Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe g als Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft. Dabei bedeutet Verfolgung „den völkerrechtswidrigen, vorsätzlichen und schwer wiegenden Entzug von Grundrechten wegen der Identität einer Gruppe oder Gemeinschaft”. Laut dem Policy Paper der Anklagebehörde des IStGH zur geschlechtsspezifischen Verfolgung richtet sich dieses Verbrechen gegen Personen aufgrund ihrer Geschlechtsmerkmale und/oder aufgrund der sozialen Konstrukte und Kriterien, die zur Definition des Geschlechts herangezogen werden. Im Sinne von Artikel 7 Absatz 3 des Römischen Statuts „bezieht sich der Ausdruck ‚Geschlecht‘ auf beide Geschlechter, das männliche und das weibliche, im gesellschaftlichen Zusammenhang.” Von geschlechtsspezifischer Verfolgung können Frauen, Mädchen, Männer, Jungen sowie LGBTQI+-Personen betroffen sein. Als Verbrechen gegen die Menschlichkeit kann geschlechtsspezifische Verfolgung sowohl in Zeiten bewaffneter Konflikte als auch in Friedenszeiten begangen werden.
Sechs Elemente müssen nachgewiesen werden, um das Vorliegen geschlechtsspezifischer Verfolgung zu begründen, wobei vier davon den materiellen Tatbestand (actus reus) bilden. Erstens muss der Täter einer oder mehreren Personen ihre Grundrechte – wie das Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit oder Bewegungsfreiheit – vorsätzlich, völkerrechtswidrig und schwerwiegend vorenthalten haben. Im vorliegenden Fall stellte die Vorverfahrenskammer II fest, dass Frauen, Mädchen sowie Personen, die ihre geschlechtliche oder sexuelle Identität außerhalb der Geschlechterpolitik der Taliban zum Ausdruck brachten, grundlegende Rechte verweigert wurden. Dazu gehörten unter anderem das Recht auf Bildung, Privatsphäre, Familienleben sowie Bewegungs- und Meinungsfreiheit. Zweitens muss die Verfolgung auf einem der in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe h des Römischen Statuts genannten Gründe beruhen – hierzu zählt auch das Geschlecht. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass Akhundzada und Haqqani aus diesem Grund handelten. Diese Feststellungen rechtfertigten den Erlass von Haftbefehlen.
Drittens muss das Verhalten mit mindestens einem weiteren Verbrechen in Verbindung stehen, das in die Zuständigkeit des IStGH fällt – etwa anderen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, Völkermord oder dem Verbrechen der Aggression. Laut der Pressemitteilung zur Bekanntgabe der Haftbefehle wurde die geschlechtsspezifische Verfolgung im Zusammenhang mit Mord, Inhaftierung, Folter, Vergewaltigung und Verschleppung begangen – allesamt Taten, die aus der Geschlechterpolitik der Taliban resultieren. Viertens muss die Handlung Teil eines systematischen oder groß angelegten Angriffs gegen die Zivilbevölkerung gewesen sein oder zumindest darauf abgezielt haben, Teil eines solchen Angriffs zu sein. Die Vorverfahrenskammer ordnete diesen Angriff der Politik der Taliban-Regierung zu. Gemäß Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a des Römischen Statuts bezeichnet ein „Angriff gegen die Zivilbevölkerung“ eine Vielzahl von Handlungen – einschließlich geschlechtsspezifischer Verfolgung –, die im Rahmen einer staatlichen oder organisatorischen Politik gegen Zivilpersonen verübt werden.
Zwei weitere Elemente, die sich auf den Vorsatz des Täters (mens rea) beziehen, müssen nachgewiesen werden, um eine geschlechtsspezifische Verfolgung zu belegen. Der Täter muss gewusst oder beabsichtigt haben, dass das Verhalten Teil eines weit verbreiteten oder systematischen Angriffs auf die Zivilbevölkerung ist, und er muss Personen aufgrund ihrer Gruppenidentität oder Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft ins Visier genommen oder die Gruppe oder Gemeinschaft als solche angegriffen haben. In Fällen geschlechtsspezifischer Verfolgung kann die diskriminierende Absicht auf geschlechtsspezifischen Kriterien beruhen, die der Täter einer Gruppe oder Gemeinschaft auferlegt, wie etwa stereotypen Rollen, Verhaltensweisen, Aktivitäten und Eigenschaften sowie physiologische Merkmale oder Eigenschaften, die Männern und Frauen zugeschrieben werden. Der Fall Al Hassan zeigt, wie Erwartungshaltungen, zum Beispiel, dass Frauen zu Hause bleiben, um Kinder zu betreuen und Hausarbeit zu verrichten, eine solche diskriminierende Absicht des Täters widerspiegeln können.
Wichtig ist, geschlechtsspezifische Verfolgung von „Geschlechterapartheid“ zu unterscheiden, die derzeit trotz Forderungen von Organisationen der Zivilgesellschaft kein Verbrechen nach Völkerrecht darstellt. Einige Staaten haben jedoch während der Verhandlungen ihre Unterstützung für die Aufnahme von „Geschlechterapartheid“ in den Entwurf des Vertrags über Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Ausdruck gebracht, wie aus dem Entwurf der Völkerrechtskommission von 2019 hervorgeht.
4. Wie sehen die nächsten Schritte im Verfahren aus?
Die nächsten Schritte im Verfahren gegen Akhundzada und Haqqani umfassen ihre Festnahme und Überstellung an den IStGH, woraufhin sich die Vorverhandlungsphase bis zur Bestätigung der Anklage anschließt. Gemäß Teil 9 des Römischen Statuts sind die Vertragsstaaten des Römischen Statuts, darunter auch Afghanistan, verpflichtet, bei der Untersuchung und Verfolgung von Straftaten uneingeschränkt mit dem IStGH zusammenzuarbeiten. Dazu gehört auch die Pflicht, Ersuchen um Festnahme und Überstellung nachzukommen. Eine solche Entwicklung scheint jedoch unwahrscheinlich, da der Sprecher der Taliban, Herr Zabihullah Mujahid, kürzlich erklärte, dass Afghanistan den IStGH nicht mehr anerkennt und auch keine Verpflichtungen ihm gegenüber anerkenne. Bis heute hat Afghanistan dem Generalsekretär der Vereinten Nationen keine formelle Absichtserklärung zum Austritt aus dem Römischen Statut übermittelt, wie dies kürzlich beispielweise Ungarn getan hat. Eine andere Frage ist, ob das von der internationalen Gemeinschaft weitgehend nicht anerkannte Taliban-Regime die Befugnis hat, die Mitgliedschaft Afghanistans im IStGH wirksam zu beenden.
Die Haftbefehle stellen eine bedeutende Entwicklung dar, da es das erste Mal ist, dass ein internationales Gericht anerkannt hat, dass LGBTQI+-Personen aufgrund ihres Geschlechts Opfer von Verfolgung werden können. Diese Einschätzung stammt von Lisa Davis, Sonderberaterin für Geschlechterfragen und andere diskriminierende Straftaten bei der Anklagebehörde des IStGH, die diesen Schritt als besonders bedeutsam hervorhob. In diesem Zusammenhang begrüßt Professor Dr. Christoph Safferling, Direktor der Internationale Akademie Nürnberger Prinzipien, den Erlass der Haftbefehle als „positive, jedoch verhalten optimistische Entwicklung“. Er merkt an, dass dies „eine strategische Entscheidung der Anklagebehörde des IStGH widerspieglt, sich im Rahmen ihrer umfassenderen Bemühungen um Rechenschaftspflicht auf hochrangige politische und militärische Führungskräfte zu konzentrieren”. Dieser Ansatz unterstreicht zwar das Engagement des IStGH, mutmaßliche Verbrechen auf höchster Ebene zu ahnden, doch Professor Safferling betont auch die damit verbundenen Herausforderungen bei der Durchsetzung. Er stellt fest, dass angesichts anderer laufender Verfahren vor dem Gerichtshof – beispielsweise in Bezug auf die Ukraine und Palästina, wo Haftbefehle gegen hochrangige Persönlichkeiten wie Präsident Wladimir Putin und Premierminister Benjamin Netanjahu erlassen wurden – „der Erlass solcher Haftbefehle zwar symbolisch und rechtlich bedeutsam ist, aber nicht automatisch zu einer Festnahme und Auslieferung führt“. Dennoch würdigt er diesen Schritt „als umsichtige Bekräftigung des Mandats des Gerichtshofs und als einen Schritt zur Förderung der Rechenschaftspflicht auf höchster Machtstufe, wie uns das Nürnberger Prinzip III in Erinnerung ruft“. (pg)

![[Translate to Deutsch:] Zu sehen ist eine Außenaufnahme des Eingangsbereichs des Internationalen Strafgerichtshofs, eines Bauwerks aus Beton und Glas, das teilweise mit Pflanzen bewachsen ist.](/fileadmin/_processed_/4/a/csm_International_Criminal_Court_Building_1efc102663.jpg)